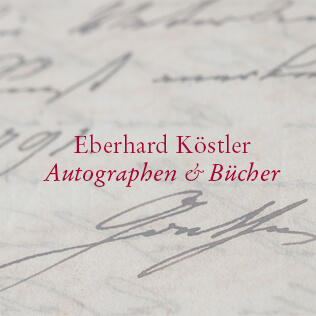Beschreibung
Einer der frühesten im Handel befindlichen Briefe Lou Andreas-Salomés, geschrieben an die Jugendfreundin „Misulka“ während der ersten Reise nach Paris 1894, reich an Anspielungen und Bezügen auf das Leben und die Denkweise der sich emanzipierenden, allein reisenden jungen Frau: „Liebste Misulka! Ich freute mich so sehr als ich so bald nach meiner Ankunft Deinen Brief hierher bekam, und nun ist doch schon ein Monat vergangen, ohne daß ich Dir geantwortet hätte. Aber dieser erste Monat der ‚Akklimatisation‘ ist nur so hingeflogen, wie Du Dir denken kannst, und namentlich kam ich nicht zum Schreiben, weil mein Zimmer eng und klein und unbequem war; ich möchte aber dieses Hôtel um der vornehmen Gegend willen in der es liegt, und die für eine einzelne Dame sehr vorzuziehen ist. Nach einiger Zeit ziehe ich etwas weiter hinaus, wo es ländlicher, frischer und geräumiger ist. Das brauche ich auch zum Arbeiten, welches nun ordentlich anfangen muß, ich habe drei französische Revue’en schon, an die ich Arbeiten einsenden kann, – natürlich thu‘ ich das deutsch, die Redaktion übersetzt sie. Noch ist Fräulein Krüger (die Dänin, weißt du) mit mir hier, aber bald reist sie schon fort. Von Mitte April an erwarte ich Mauthner und zum Mai Frieda von Bülow, die direkt von Afrika herkommt und wohl ein paar Monate bleibt. Während dieser Zeit habe ich mich wiederholt gefragt, wie es Dir wohl gefallen würde, wenn Ihr einmal herkämt. Paris ist als Stadt so prachtvoll, so voll von Glanz und Erinnerung, so merkwürdig und imposant zugleich, daß man sich schon eine Weile am rein äußeren Leben berauschen kann. Mehr noch, wenn man die Zeitungen und Journale liest, in denen hier die besten Schriftsteller des Landes mitpolitisieren, denn hier drängt und lebt alles nach außen hin, sozusagen auf der Straße und in den Erregungen des Tages, – die Persönlichkeiten werden zerrieben. Und alles beherrscht der ungeheure Contrast einer auf’s Aeußerste raffinierten, überbildeten Gesellschaft des Luxus, und eines Elends, das sich fortwährend in revolutionären Stimmungen Luft macht, weil es um sich diesen Glanz sieht und von dieser großen Schönheit umgeben ist und dabei darben muß. Das alles ist von höchstem Interesse, aber um dieses Paris zu verstehen, muß man es schon bei Tag und bei Nacht, oben und unten; man muß auch, wie wir es gethan, mit zuverlässiger Herrenbegleitung, die Seitenstraßen und Winkel aufsuchen, den vierten Stand bei seiner Arbeit, seinem Vergnügen und seinem Laster beobachten, denn der vierte Stand ist hier die Zukunft. Das wirkt doppelt seltsam, wenn man von einer Schampagnertrinkenden Gesellschaft herkommt. Einstweilen verkehren wir hier in ein paar Ateliers, bei ein paar Verlegern, in einem Professorenhause und, mit Eröffnung der eigentlichen Salons, – die Saison fängt erst an, – will ich noch bei der Madame Adam und bei dem Conte d’Orval verkehren. Zwei ständige Herren habe ich mir als zuverlässig herausgefischt zur Begleitung für dies und das, ( – die Franzosen sind entsetzliche Leichtvögel) der Eine heißt Dr. Goldmann und vertreibt die Frankfurter Zeitung in Paris, ist praktisch, gewandt, erfahren, ruhig und umsichtig; der Andere Henri Albert, ein noch junger, etwas elegischer Elsässer, ist redacteur der Societé nouvelle. Von Frauen habe ich nur eine sympathische kennen gelernt, – die Französinnen sind gräßlich: eine Gräfin Nemethy, Ungarin von Geburt, von unserem Alter und von litterarischem Interesse. Ich werde dir bald mehr von Paris schreiben, laß mich oft wissen, wie es dir geht und bei euch steht, ja? Denke ja nicht, daß mein Nichtschreiben ein Nichdeinerdenken wäre, ich lebe nun auch gezwungener Weise nach außen. Von meinem Mann habe ich leidliche Nachrichten, von Mama auch; hier ist schon voller Sommer, Magnolien und Kastanien blühen in den Tuillerien und dem Bois de Boulogne. Für heute addio, Liebste, nimm Vorlieb! Grüße bitte deine Mama und sei innig abgeküßt von deiner Lou.“ – Vom 27. Februar 1894 bis September desselben Jahres weilte Lou Andreas-Salomé zum ersten Mal in Paris, ohne ihren damaligen Mann Friedrich Carl Andreas, von dem sie, wie sie hier schreibt, „leidliche Nachrichten“ erhielt. Aus dem Brief geht hervor, welch immensen, aber auch zwiespältigen Eindruck Paris auf Lou machte, da sie sowohl die Großartigkeit der Stadt, als auch deren Armut wahrnahm. Bei der „zuverlässigen Herrenbegleitung“, die sie erwähnt, dürfte es sich um Frank Wedekind gehandelt haben, den sie im Salon der Gräfin Nemethy kennenlernte. Die Begegnung mit Wedekind in Paris hat Lou Andreas-Salomé in „Fenitschka“ literarisch verarbeitet. Verbürgt ist, dass sie den Dichter in den ärmsten Teil von Paris zu einem Besuch bei Georg Herweghs Witwe begleitete. „Lou Andreas-Salomé nimmt die Pariser Armut, deren groteske Gesichter Rilke nach ihr so tief erschrecken werden, gelassen, wie etwas Selbstverständliches. Etwas Selbstverständlichem geht man nicht aus dem Wege“ (Decker, S. 178). Bei den beiden im Brief namentlich genannten Herren handelt es sich zunächst um Henri Albert (Henri-Albert Haug; 1869-1921), der Friedrich Nietzsche ins Französische übersetzte. Von Teodor de Wyzewa schon 1896 als „l’apôtre fidèle du nietzschéisme“ bezeichnet, wurde Alberts Nietzsche-Deutung maßgeblich „von Lou Andreas-Salomé beeinflußt“ (Reckermann, S. 7). Der zweite genannte Begleiter ist Paul Goldmann, Korrespondent der Frankfurter Zeitung in Paris. Mit ihm verband Lou Andreas-Salomé ein inniges Verhältnis, auf Seiten Goldmanns wohl auch eine innige Schwärmerei, der er sich nicht gewachsen fühlte, weshalb Goldmann in seinem Abschiedsbrief am 26. September, kurz vor Lous Abreise, schrieb: „Ich hätte Ihnen nie als Herr gegenüberstehen können, und der Sklave einer Frau will ich nicht sein, selbst Ihrer nicht“ (Decker, S. 187). Die hier gleichfalls erwähnte Afrika-Reisende, Abenteurerin und Schriftstellerin Frieda von Bülow, die Lou Andreas-Salomé im Mai in Paris erwartete, beobachtete die Affäre zwischen Goldmann und ihrer Freundin aufmerksam und nahm diese zum Anlass für eine Erzählung über Lou Andreas-Salomé und ihre männlichen Bekanntschaften mit dem Titel: die „Goldmanniade“ (Decker, S. 182). – Vgl. Kerstin Decker, Lou Andreas-Salome. Der bittersüße Funke Ich. Berlin 2012, S. 174 ff.; Alfons Reckermann, Lesarten der Philosophie Nietzsches, Berlin 2003, S. 7. – Mit kleinem Randeinriss in der Falte.