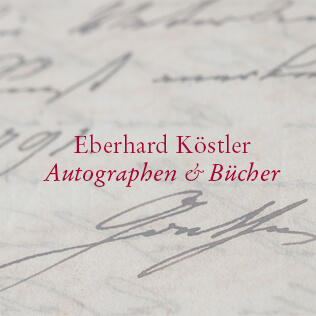Beschreibung
Inhaltsreicher Brief an den kaiserlichen Obersthofmeister Rudolph von Liechtenstein (1838-1908) auf Schloß Neulengbach bei Wien, der seit Wagners Wiener Zeit (1861-1863) ein Bewunderer und Förderer des Komponisten war und dessen Auftrag sie gerne erfüllen will: „[…] zwischen der so heiter beschlossenen, willig übernommenen Bestellung und ihrer baldigen Abschließung, gab es wirklich Raum für ein Unglück, und einen Monat Schweigen birgt […] nothwendig ein Unheil in sich. Das welches Sie betroffen, ist mir völlig unerklärlich; wo sind die Runen für dieses Rätsel? Sehr gerührt aber hat es mich dass in Ihrer augenblicklichen Stimmung Sie die, wenn nicht gerade heitere, doch freiere Stimmung meines Briefes gut aufgenommen, ja selbst erwidert haben! Und in diesem Gefühl habe ich den Pentameter korrigiert, dabei bemerkend dass Sie es mit dem melodisch Herabfallenden genauer nehmen als Goethe mit dem Hextrameter: als Riemer ihn ein Mal auf einen Fuss zu viel aufmerksam machte, war er zuerst stutzig, dann rief er: lass die Bestie laufen […] den 19ten dieses Monats kehren wir wirklich in Wien ein, den 20ten ist Lohengrin (vorläufig noch deutsch!), und am 21ten sollen Unger und Materna die letzte Scene von Siegfried einem Publikum darunter sich keine Jubilare befinden werden, vortragen. Darauf gehen wir nach Berlin, wo man ‚Tristan‘ als Fastnachts-Scherz zu geben scheint! Aspasia [Roman von R. Hamerling] ist noch nicht angekommen, ich werde sie aber vor der Abreise nicht beginnen; ich such eine englische Biographie Schopenhauers, von einer Frau mit einem vortrefflichen Sinn geschrieben, zu Ende zu bringen, und gewahre dabei mit Grauen wie sich ein Wesen von so abnormer Begabung in unserer heutigen Welt ausnimmt. Der Drang zur Erkenntniss, die einzige Liebe zur Wahrheit, welche Sokrates zu einer liebenswürdigen excentrischen Erscheinung bei den Hellen[en] stempeln, machen unter uns aus Schopenhauer eine Fratze, die ich am liebsten nicht zeigen möchte, um die Wirkung seiner Lehren nicht zu hemmen. So erscheint alles trübselig! Man kann sich kaum mehr über eine Gabe freuen welche dem einen zufällt, sei es Geist oder sonstige Habe, und doch wenn er es verliert schmerzt es einem als ob es ein Glück gewesen. Am Ende handeln diejenigen die sich zerstreuen aus einem tiefen Instinkt, nur ist er demjenigen dem er nicht gegeben, fremd bis zur Verächtlichkeit. Ich hoffe aber doch sie gefasst in Wien zu finden […]“